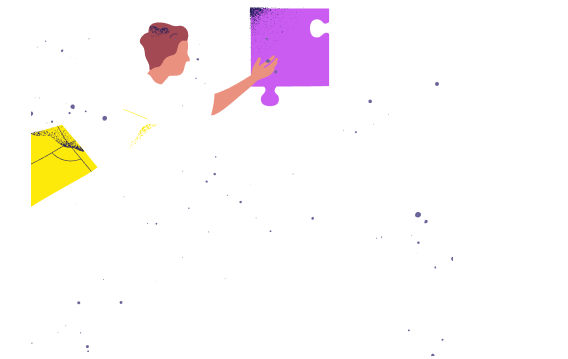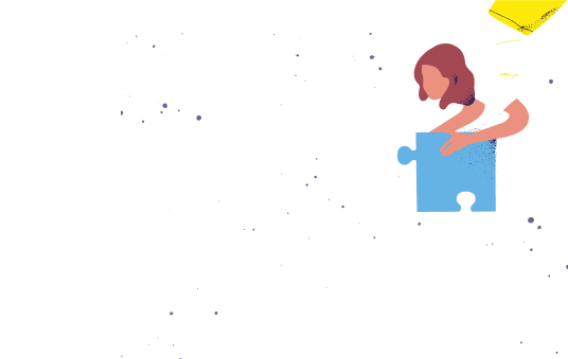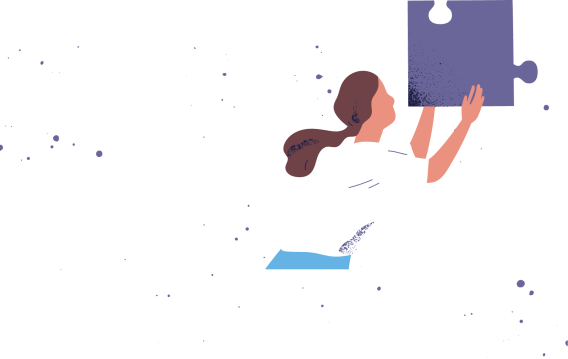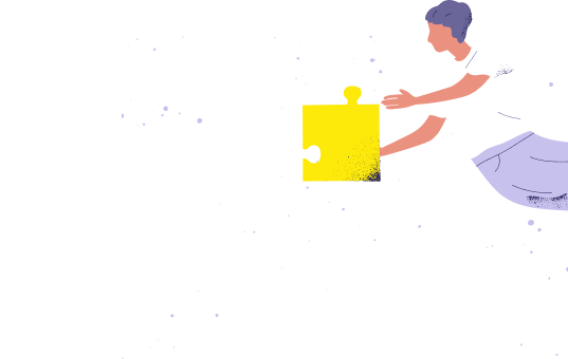Urvertrauen auf der Kippe
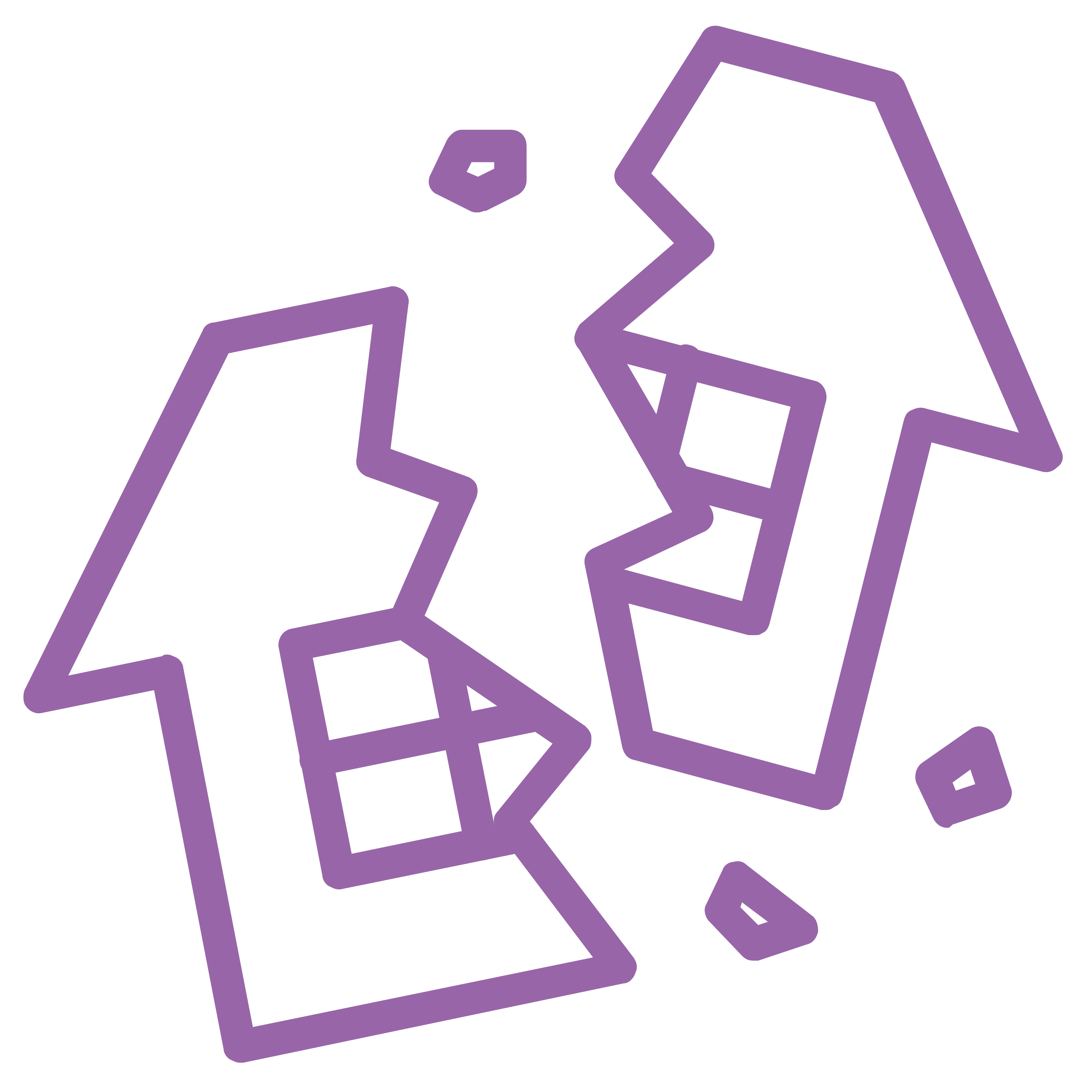
Rund jede zweite Ehe in Deutschland wird laut Statistischem Bundesamt geschieden. Die Anzahl der minderjährigen Scheidungskinder lag im Jahr 2022 in Deutschland bei mehr als 115.000. Trennungen von nicht verheirateten Elternteilen werden statistisch nicht erfasst.
Wie gehen Kinder mit einer Trennung um?
Eine Trennung der Eltern belastet Kinder in der Regel stark. Oft leiden sie an Schuldgefühlen oder Loyalitätskonflikten. Wie Kinder mit einem Verlust umgehen, ist sehr individuell und hängt von verschiedenen Faktoren ab. So spielen Alter und Entwicklungsstand des Kindes, die seelische Grundverfassung sowie seine individuellen Fähigkeiten zur Angstbewältigung und Anpassung eine bedeutende Rolle. Ausschlaggebend für das kindliche Erleben ist außerdem die Qualität der Beziehung zu beiden Eltern vor und nach der Trennung und die Möglichkeit der Eltern, die Trennung zu bewältigen und in der Erziehung weiterhin zusammenzuwirken. Auch die sozio-ökonomische Situation der ursprünglichen und der zukünftigen Familie und das seelische Befinden der Eltern wirken sich auf den Verarbeitungsprozess des Kindes aus.
Körperliche, psychische und soziale Folgen
Kinder, die über gute Bewältigungsstrategien im Umgang mit krisenhaften Situationen verfügen, sicher gebunden und resilient sind und deren Eltern die Trennung respektvoll und wohlwollend vollziehen, können gut durch diese anspruchsvolle Zeit kommen. Besonders jüngere Kinder zeigen jedoch oftmals deutliche Symptome wie:
- Rückzug
- Niedergeschlagenheit
- Lustlosigkeit
- irrationale Ängste
- Schuld- und Schamgefühle
- Verlustängste
- Schlafstörungen
- aggressives Verhalten
- regressives Verhalten
- Leistungsabfall in der Schule
- Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten
- psychosomatische Beschwerden
Auch ältere Kinder und Jugendliche reagieren zum Teil stark auf eine Trennung der Eltern: Einige wehren Entwicklungsanforderungen des Erwachsenwerdens ab; andere hingegen zeigen pseudoerwachsenes Verhalten. Die genannte Liste kann sich auch in dieser Altersgruppe fortsetzen.
Wichtig: Alle Symptome sind unbewusste Bewältigungsstrategien bzw. Abwehrmechanismen der Kinder und ein Versuch, mit der Überforderung und Unsicherheit umzugehen. Kinder können diese Verhaltensweisen nicht bewusst steuern und sollten dafür nicht bestraft werden. Sie brauchen ein Gefühl von Sicherheit und Menschen, mit denen sie offen über ihre Gefühle, Erlebnisse und Sorgen sprechen können.
Zum Wohle des Kindes
Wir sehen: Eine Trennung der Eltern kann vielschichtige Folgen für die Kinder haben und ihr Urvertrauen in die Familie erschüttern. Doch wie können Eltern ihren Kindern weiterhin ein Gefühl von Sicherheit und Halt vermitteln?
- Kinder brauchen Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen.
- Kinder sollten auch nach der Trennung Kontakt zu beiden Elternteilen haben dürfen.
- Nicht schlecht über den anderen Elternteil im Beisein des Kindes sprechen.
- Kinder ersetzen nicht den verlorenen Partner: Wenn ein Elternteil „fehlt“, besteht die Gefahr, dass Kinder als Projektionsfläche gesehen werden.
- Um jüngere Kinder nicht zu überfordern, sollte ihr zukünftiger Wohnort durch die Eltern besprochen und festgelegt werden.
- Kinder müssen spüren: Sie sind nicht schuld an der Trennung.
- Schutzanker geben Sicherheit: ein geregelter Tagesablauf, neue und bewährte Hobbys, Sport, Bewegung, frische Luft, Kontakt zu Freund*innen, Kontakt zu weiteren Familienmitgliedern, Tiere etc.
- Eine schöne neue Routine finden.
Hilfen im Trennungsprozess
Damit Eltern und Kinder gut durch die schmerzhafte Trennungszeit kommen, ist es ratsam, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Niedrigschwellige, kostenfreie und schnelle Hilfe finden Eltern über verschiedene Angebote im Internet. Dabei kann beispielsweise das Elterntelefon eine geeignete Möglichkeit der Beratung sein. Das Pendant für Kinder ist das Kindertelefon. Die Kontakte finden Sie hier.
Weitere hilfreiche Tipps zum Thema:
Broschüre „Eltern bleiben Eltern. Hilfen für Kinder bei Trennung und Scheidung“
„Gemeinsam getrennt erziehen“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Wichtige Hinweise zu finanziellen Fragen und staatlicher Unterstützung für getrennte Eltern
Laut Kinder- und Jugendhilferecht haben alle Personen, die für ein Kind unter 18 Jahren sorgen, einen Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft. Angebote gibt es bspw. durch Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Jugendämter und den allgemeinen Sozialdienst. Die Gespräche sind vertraulich und in der Regel kostenlos. Das Beratungsangebot besteht auch bei Fragen und Problemen rund um eine Trennung, z. B. Betreuung des Kindes, Kontakt mit dem anderen Elternteil oder Unterhalt. Auch andere für das Kind wichtige Personen wie Groß- oder Pflegeeltern haben Anspruch auf Beratung.
Gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort können die Eltern entscheiden, in welchem Rahmen die Gespräche stattfinden sollen, bspw. mit oder ohne die Kinder. In einigen Beratungsstellen werden Trennungskindergruppen angeboten, in denen Kinder Bewältigungsstrategien erlernen und sich auf spielerische Art mit dem Thema auseinandersetzen. Die Gemeinschaft mit anderen betroffenen Kindern kann sie stärken und das Gefühl vermitteln, dass sie nicht allein sind. Die Eltern werden in die Arbeit mit einbezogen.
Für manche Familien kann eine Familientherapie sinnvoll sein. Sie kann u. U. über das Jugendamt finanziert werden. Auch die bereits genannten Beratungsstellen bieten z. T. familientherapeutische Gespräche an. Daneben gibt es auch niedergelassene Familientherapeut*innen. Die Kosten dafür müssen von Familien selbst getragen werden.
Wie auch immer die Hilfe ausfallen mag – Kinder sollten einen geschützten Raum erhalten, um ihr Urvertrauen in die Familie – und nicht zuletzt in sich selbst – in dieser schwierigen Lebensphase wiederzufinden.