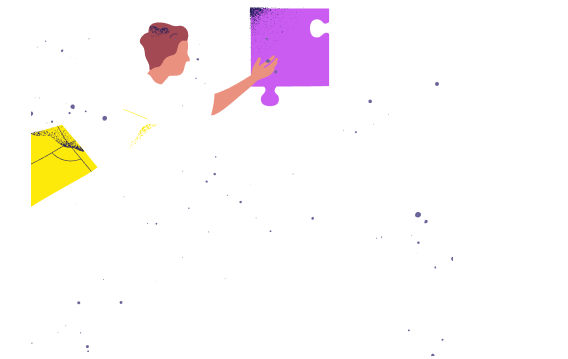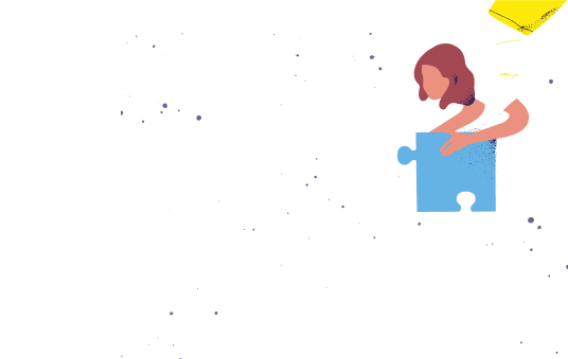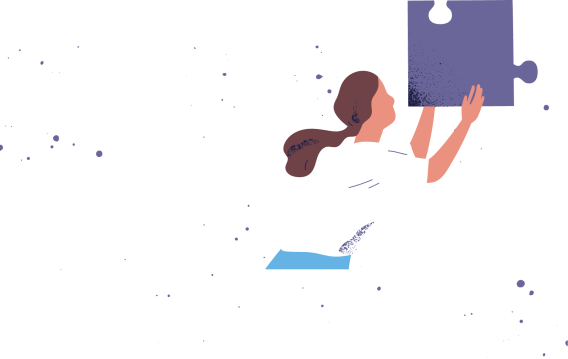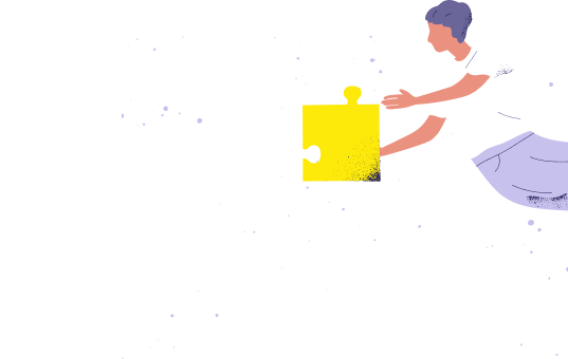Interview mit einer Betroffenen
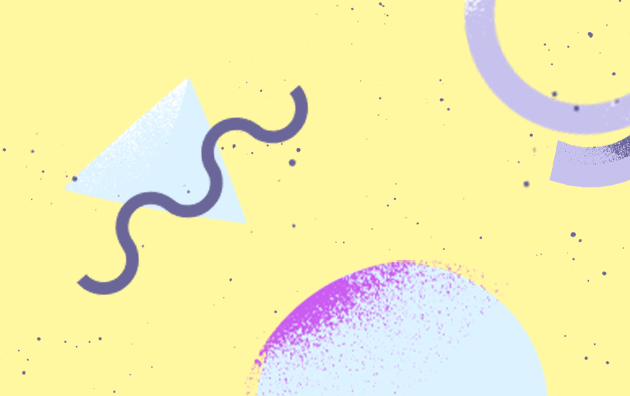
Vor einigen Wochen haben wir ein Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter aus Mecklenburg-Vorpommern geführt, die selbst an einer psychischen Erkrankung leidet. Als Betroffene aber auch als Kind einer psychisch erkrankten Mutter sprachen wir mit ihr über ihre Erfahrungen mit dem Thema Stigmatisierung.
Liebe Frau S. (Name von der Redaktion geändert), vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch. Und natürlich auch für Ihre Bereitschaft, über Ihre Erfahrungen mit dem Thema Stigmatisierung zu sprechen.
Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich wohne mit meinem Partner und meinem Sohn zusammen und habe viel studiert und sehr viele Ausbildungen absolviert. Ich habe einen Bachelor in Erziehungswissenschaften, einen Master in Sprachen und Kommunikation absolviert und bin dann in die Ausbildung der Elternberaterin und Entspannungstrainerin gegangen. Ich habe dann die EX-IN-Genesungsbegleitungsausbildung (gemeint ist der Verein EX-IN Mecklenburg-Vorpommern e. V.; Anmerkung der Redaktion) gemacht und bin so in meinem jetzigen Job gelandet und leide unter Ängsten, Depressionen und einer Suchtproblematik. Wie sich in den letzten Wochen herausgestellt hat, kann man das unter dem Begriff Traumafolgestörung klassifizieren und sich hat sich für mich nochmal ein ganz neuer Behandlungspunkt ergeben. Denn 20 Jahre Therapie hatten bisher nicht nachhaltig etwas an den Symptomen verändert. Jetzt habe ich nochmal einen neuen Blickwinkel.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Thema Stigmatisierung? Also einerseits aus Sicht einer erkrankten Mutter, aber auch als betroffenes Kind aus heutiger Sicht als Erwachsene.
Also bei meiner Mutter habe ich Stigmatisierung in Form von abfälligen Bemerkungen erlebt sowas wie „Ach die ist ja nicht ganz dicht.“ oder „Die muss sich nur zusammenreißen.“.
Von der Familie weiß ich, dass immer gesagt wurde, mein Vater soll sich scheiden lassen. „Das geht so nicht.“, „die ist in die Klapse.“ oder „die ist verrückt.“ Also das Reden über die psychische Erkrankung meiner Mutter ist sehr negativ abgelaufen, so dass ich bis zu einem bestimmten Alter auch selber nicht über meine Symptome gesprochen habe, weil ich mich das gar nicht getraut habe zu sagen, „ich habe auch Ängste, mir geht es auch oft nicht gut.“ Und ich selber habe es erlebt durch den Vater meines Sohnes, der mich immer unter Druck gesetzt hat in der Beziehung, wenn ich diese beenden wollte, weil ich in der Beziehung sehr unglücklich war und es dann immer hieß „... dann nehme ich dir das Kind weg, du hast ja einen an der Klatsche“.
Bevor ich mich getrennt habe, habe ich mich dann getraut, mich beim Jugendamt beraten zu lassen, welche Möglichkeiten er hätte, mir mein Kind wegzunehmen, weil ich unter einer psychischen Erkrankung leide. Und da wurde mir wirklich sehr wohlwollend gesagt „nein, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nur weil jemand Angst hat oder Depressionen hat, nimmt man Ihnen Ihr Kind nicht weg“. Also dann bin ich zum Glück auf sehr wohlwollende Menschen gestoßen, die mich auch weiterhin sehr gut unterstützt haben, bspw. bei der Umgangsgestaltung.
Und dann bin ich in einer beruflichen Reha ganz oft auf den Satz gestoßen „Psychisch Kranke dürfen nicht mit Menschen arbeiten.“ Mich direkt hat es nicht betroffen, weil bei mir eine Ausnahme gemacht wurde und gesagt wurde „Naja, Sie sind ja schon Profi. Sie sind ja schon in dem Bereich als Sozialpädagogin tätig.“ Aber meine Freundin zum Beispiel betraf es, die auch in dieser Maßnahme war und viele andere Teilnehmer auch.
Ich hatte damals noch nichts von EX-IN gewusst, aber als ich dann die EX-IN-Ausbildung gemacht habe, hatte ich dort nochmal angerufen und mit einer Dozentin gesprochen, um ihr zu sagen, dass dieser Satz nicht geht. Und ob sie nicht in Zukunft zusammen mit dem Verein EX-IN das Problem dieser Stigmatisierung ein bisschen aufweichen wollen.
Wie waren ihre Erfahrungen als Kind?
Naja, dass sie (meine Mutter, Anmerkung der Redaktion) nicht immer stabil war, dass sie selber Angst hatte mit uns allein zu sein. Sie war überfordert. Ich habe noch eine drei Jahre ältere Schwester und wir mussten uns immer viel unserer Mutter anpassen. Mein Vater arbeitete im Schichtdienst, war also nicht wirklich verfügbar. Ich hatte immer Angst, mein erstes Gefühl, an das ich mich erinnern kann, ist Angst, Unsicherheit, Sorge.
Haben Sie deshalb als Kind Erfahrungen mit Ausgrenzung und/oder Mobbing durch Kinder oder Erwachsene gemacht.
Nein, da kann ich mich so direkt nicht dran erinnern. Ich weiß, dass die Lehrer sehr wohlwollend waren. Meine Mutter hatte eine ganz schwere Zeit, da war ich 16 Jahre alt und in der 10./11. Klasse da war sie sehr lange in der Klinik und sehr schwer depressiv, und dort haben meine Mitschüler und Freunde sogar bei mir geschlafen, um meine Einsamkeit etwas aufzufangen. Ich war ja damals alleine mit meinem Vater. Ich habe mich damals eher unterstützt gefühlt. Aber wir haben auch nie wirklich darüber gesprochen. Mein Vater hat auch nie darüber gesprochen in der ganzen Zeit als meine Mutter in der Klinik war. Er hat insgesamt eher abwertend darüber geredet also „Sie muss sich zusammenreißen.“. Solche Sätze sind fast nur gefallen, so dass ich auch nie versucht habe, mit meinem Papa darüber zu sprechen, dass es mir auch sehr nahe geht und dass es mir nicht gut geht.
Ich kenne eben persönlich von meinem Ex-Freund die Aussage „das ist alles Gemache“ also, wenn ich Angst- oder Panikattacken habe und mein Vater war ähnlich. Als bei mir mit 19, 20 Jahre die Angststörung so richtig ausbrach, da konnte ich mir von meinem Vater und meiner Schwester oft anhören „Du wirst langsam echt wie Mutti“ also wirklich abwertend. Also eher so „reiß dich zusammen“.
Sie haben berichtet, dass Sie als Kind Erfahrungen mit Stigmatisierung erfahren haben. Was würden Sie sagen, was hätte Ihnen als Kind damals in der Situation geholfen? Wer oder was war damals hilfreich für Sie als Kind?
Bei mir ist es, dass ich ein Bindungstrauma habe, weil meine Mutter mich die ersten Wochen meines Lebens hat durchschreien lassen hat. Das heißt, mein Nervensystem ist überreizt und ich hatte nie die Chance, ein gesundes Nervensystem in Ruhe und Entspannung zu entwickeln. Aus heutiger Sicht, es hätte Möglichkeiten gegeben. Sie hätte sich Hilfe holen können, sie hätte ihre Mutter anrufen können, die wäre gekommen. Sie hätte meine andere Oma anrufen können, die wäre gekommen. Sie hat nicht nach Hilfe gerufen, sie hat das einfach zugelassen. Sie hat sich in ihrem Schmerz hängen lassen und mich damit auch.
Mir ist jetzt bewusst geworden, ich hatte gute Bezugspersonen. Meine Erzieherin in der Krippe, da wurde ganz viel reguliert. Und bei meinen Großeltern väterlicherseits hatte ich immer ein Zuhause-Gefühl. Die haben sich liebevoll gekümmert, die waren stabil, die waren da und die haben viel mit uns gemacht und uns immer das Gefühl gegeben, dass wir sicher sind.
Also kann man zusammenfassend nochmal sagen, dass familiäre Beziehungen wie Großeltern, Tante, Onkel aber auch andere soziale Ressourcen wie Erzieher*innen also liebevolle, stabile Bezugspersonen sehr wichtig sind für ein gesundes Aufwachsen für Kinder in dieser Situation.
Ja, genau.
Haben Sie die Erfahrung als Betroffene machen müssen mit Stigmatisierung in Ihrem heutigen Umfeld? Sie haben mir auch erzählt, dass Sie einen Sohn haben. Haben Sie erlebt, dass er berichtet hat, dass er Ausgrenzungserfahrungen oder Mobbing erleben musste?
Nein. Ich habe mir mit dem Wissen aus meiner Kindheit immer viel Hilfe und Unterstützung gesucht.
Im ersten halben Jahr war der Vater auch zu Hause, so dass wir uns gut abwechseln konnten. Trotzdem ist es zu einer Traumatisierung gekommen aufgrund einer Gewalterfahrung, die er mit ansehen musste als er drei war. Und hat daraufhin auch Traumafolgestörungen entwickelt, die gut behandelt wurden. Das heißt, ich bin seit seinem dritten, vierten Lebensjahr mit ihm bei einer Psychologin, so dass wir immer gut über alles sprechen konnten. Und alles gut aufarbeiten konnten. Bei ihm zeigte sich das im Kindergarten, Vorschule, 1., 2. Klasse und dann kam Corona, so dass wir uns noch besser aufteilen konnten. Er hat eine soziale Phobie, eine soziale Ängstlichkeit. Mittlerweile merkt man ihm die gar nicht mehr an. Er ist offen.
Ausgegrenzt wurden wir in dem Sinne, dass es nie ernst genommen wurde von Seiten des Vaters und auch von meiner Familie. Meine Familie hat uns damals im Stich gelassen nach der Trennung, weil sie der Version meines Ex-Freundes geglaubt haben und sich dann von uns abgewandt haben, so dass ich für meinen Sohn leider nicht diese Stabilisierung durch Großeltern, Onkel oder Tante habe, so dass ich das in erster Linie bewältige. Ich war aber immer sehr offen. Ich habe unsere Problematik im Kindergarten, in der Vorschule, mit dem Grundschullehrer besprochen, dass sie einfach einen guten Blick auf meinen Sohn haben. Ich habe auch immer viel Rücksprache mit dem Lehrer gehalten.
Aber Ausgrenzung hat er Gott sei Dank nicht erlebt. Ganz im Gegenteil, er hat ganz schnell immer Kumpels gehabt, die eher so vorgeprescht sind und die ihn dann mitgerissen haben. Und meine eigenen Problematiken wurden in dem Moment gar nicht thematisiert. Er hat ja noch nie gesagt „meine Mama ist krank“ oder so.
Das Thema ist ja relativ tabuisiert. Darüber reden die Kinder nicht. Aber Mobbing und Ausgrenzung kennt er zum Glück nicht. Beziehungsweise passiv, durch die Ausgrenzungssituation durch meine Familie.
Schön, dass Sie so positive Erfahrungen machen durften sich und für ihren Sohn zu früh Hilfe gesucht haben! Das war ein mutiger Schritt und hat Ihrem Sohn sicherlich sehr geholfen dabei, sich so gut zu entwickeln.
Ja, ich habe das gemacht, was ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Dieses Wissen, was sie (die Psychologin; Anmerkung von der Redaktion) ihm jetzt beibringt, die Anteile, die wir haben, warum ist Angst so wichtig?, wie kann die Angst weniger werden? und diese EMDR-Technik usw. - das hätte ich als Kind definitiv auch gebraucht, dann wäre mir als Kind sehr viel Leid erspart geblieben.
Wie nehmen Sie den Umgang mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft wahr? Erleben Sie dort Stigmatisierung?
Ich glaube, dass das Thema Selbststigmatisierung in dem Bereich sehr groß ist. Dass die Betroffenen sich aus Angst, man könnte ihnen das Kind wegnehmen usw., nicht trauen mit jemandem zu reden oder sich Hilfe z. B. durch eine Familienhilfe beim Jugendamt zu holen. Ich glaube, dass da noch viel mehr aufgeklärt werden sollte oder auch Genesungsbegleiter viel mehr aktiv werden müssen, psychisch erkrankte Mütter zu unterstützen. Also ihnen die Möglichkeit zu geben, in dem man sie unterstützt. Dass eine Mutter weiß „da kann ich zur Not anrufen und dann kommt jemand und hilft mir, mich zu regulieren, damit ich für mein Kind wieder da sein kann“. Also ich glaube in die Richtung muss noch ganz viel passieren, ganz viel Aufklärungsarbeit, dass diese Mütter sich nicht so alleine fühlen.
Ich hatte damals in der Trennungsphase auch zwei Freundinnen, die hätte ich nachts um drei anrufen können. Allein dieses Wissen, da ist jemand und der weiß, was los ist, den könnte ich nachts um drei anrufen, wenn ich hier mit Panikattacken liege, und da würde jemand kommen oder mir am Telefon helfen, mich wieder zu regulieren, damit ich meinen Sohn am nächsten Morgen wieder in den Kindergarten bringen kann. Dass er in seinem gewohnten Umfeld weiterspielen kann, weiter Kind sein kann, damit er vielleicht auch nicht alles mitbekommt.
Ein Netzwerk, an das man sich wenden kann im Notfall ist ganz wichtig. Das Schlimmste ist ja auch für eine Mutter diese Dauerangst „oh Gott, was ist mit meinem Kind, wenn….“. Ich glaube jede Mutter, die eine psychische Erkrankung hat, die vielleicht auch noch alleinerziehend ist, fragt sich: „was passiert mit meinem Kind, wenn jetzt das und das passiert…?“. Und sich da Hilfe zu holen, sich abzusichern, ist ganz wichtig.
Es gibt zum Beispiel auch sozialpsychiatrische Assistenten, also so eine Notfallnummer und die haben dann kurz stabilisierend gewirkt und sind im Hintergrund geblieben. Dass man zur Ruhe kommt und gemeinsam das Kind ins Bett bringt. Das war Gold wert, weil ich auch nicht immer jemanden hatte, den ich anrufen konnte. Das muss auch jemand im Hintergrund sein, der auch sehr verlässlich ist.
Wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Gibt es noch etwas, was Sie gerne sagen möchten?
Es ist so wichtig, die Mütter gezielt zu unterstützen, dass die Kinder sich gesund entwickeln können, dass die Kinder trotzdem ihre Bezugspersonen haben und sich was Stabiles, Sicheres aufbauen kann.
Liebe Frau S., vielen Dank für Ihre Offenheit mit unser über dieses sensible Thema und Ihre Erfahrungen sprechen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
Das Gespräch mit Frau S. führte Julia Möller.