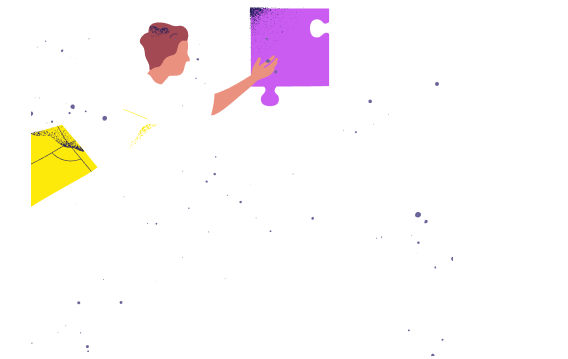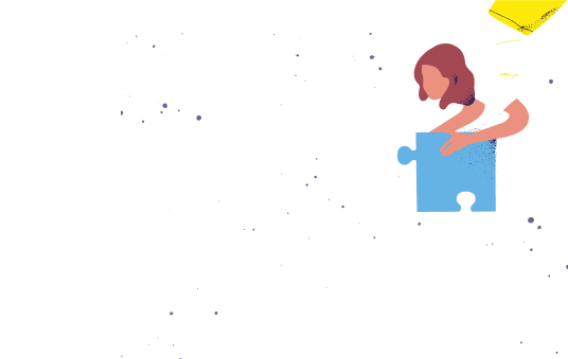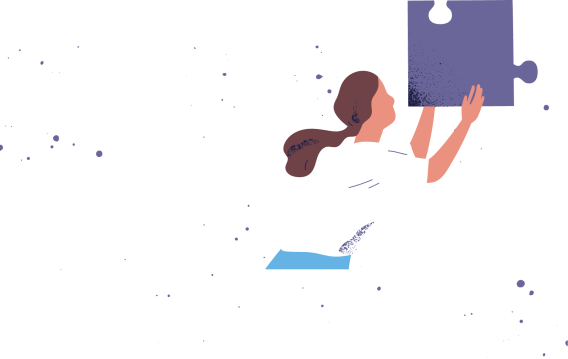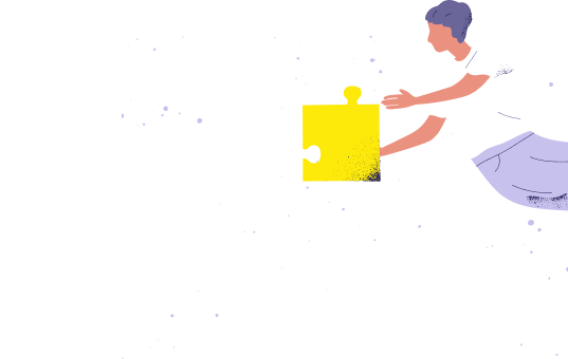Interview Juliane Tausch
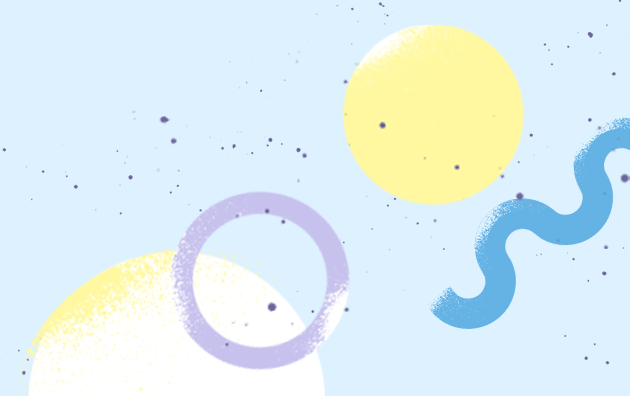
„Nichts tun ist keine Möglichkeit.“
Können Sie uns am Anfang ein wenig zu Ihrer persönlichen Berufsbiografie erzählen und welchen Bezug Sie zu unserem Bundesland haben?
Während meiner Schulzeit in Berlin und Brandenburg war ich bis kurz vor Ende meiner Abiturzeit davon überzeugt, Steuerberaterin zu werden. Doch Freundinnen hatten mich eingeladen, die Sommerferien als Betreuerin in einem Ferienlager zu verbringen. Das war im Sommer 1997 in Seifhennersdorf, als die große Flut in Sachsen und Brandenburg den Alltag beherrschte. Dort habe ich im Dauerregen meine ersten pädagogischen Erfahrungen gemacht.
An meiner Schule gab es eine sehr gute Studienberaterin, die mich unterstützte auszufinden, was ich wirklich machen wollte. Ein Praktikum an einer Schule für körperbehinderte Kinder hat dann meine Entscheidung bestärkt, Soziale Arbeit zu studieren Das tat ich an der FH Lausitz mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik und Rehabilitation.
Nach Beendigung des Studiums habe ich in einer Rehaklinik für Kinder mit dem Schwerpunkt Kardiologie und Onkologie angefangen, mich in meiner Arbeit mit dem Thema Familienorientierung auseinanderzusetzen. Als Sozialarbeiterin musste ich mir jede Region der Patient*innen und ihrer Familien neu erschließen, da wir bundesweit belegt wurden. Ich war mit sehr komplexen Versorgungsbedarfen, Lebenslagen und mit den Themen Leben und Tod konfrontiert. Schon hier brauchte ich eine systemübergreifende Perspektive und gute Vernetzungen. Dazu kam ein berufsbegleitendes Studium der Klinischen Sozialarbeit. 2004 bin ich nach Hamburg gezogen und war dort bei einem freien Träger der Jugendhilfe als Sozialarbeiterin in den ambulanten Hilfen zur Erziehung tätig. Im Zuge des Bundeskinderschutzgesetzes hatte sich auch mein Träger in den Frühen Hilfen engagiert, ein Sozialraumangebot und einen Arbeitskreis initiiert. Hinzu kam die Gründung des Projektes ‚Wellengang‘ mit dem Fokus auf Familien mit psychischen Belastungen. 2015 bin ich dann als Teamleitung zu einem Träger der Behindertenhilfe gewechselt. Hier haben wir Familien mit Kindern begleitet, die Förderung im Bereich der körperlichen, psychosozialen und kognitiven Entwicklung benötigten - also Eingliederungshilfe, Pflegeleistungen und Familienhilfe bekamen. Komplexe Lebenslagen, Integration von verschiedenen Hilfeleistungen und ein systemischer Blick auf die Familien waren hier wieder mein roter Faden.
Nach zusätzlichen Qualifizierungen zur Kinderschutzfachkraft und Supervisorin habe ich dann den Schritt in die Freiberuflichkeit gewählt. Während der ganzen Jahre habe ich beim Arbeitskreis des PARITÄTISCHEN in Hamburg zum Thema Familien mit psychischen Belastungen mitgewirkt. Vor allem unter der Motivation, wie man das Thema strukturell in Hamburg voranbringen und sichtbar machen sowie mehr regelhafte Beratung und Hilfe für belastete Familien ermöglich kann, haben wir das Konzept zu A: aufklaren entwickelt (natürlich hieß es damals noch nicht so). Mit der Förderung durch die Auridis Stiftung, die vor allem in nachhaltige Projekte investiert, konnten wir im September 2019 unter dem Dach des Der PARITÄTISCHE Landesverband Hamburg starten.
Mit Mecklenburg-Vorpommern verbinde ich die wunderbare Ostsee, den Darß, eine gemeinsame ostdeutsche Sozialisation und natürlich die Lako KipsFam, wo ich vor allem die kollegiale Zusammenarbeit schätze.
Wie ist das Projekt in Hamburg verortet und wer gehört zu Ihren Netzwerkpartnern?
A: aufklaren ist ein dezentrales Projekt, das auf Landes- und Bezirksebene verortet ist.
Der PARITÄTISCHE Landesverband Hamburg bietet eine vielfältige Plattform, das Thema „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ aufzugreifen und Initiative für diese Zielgruppe zu ergreifen.
Wir wollen eine gesamtgesellschaftliche Zuständigkeit fördern, Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern zu begleiten, Teilhabe und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Dabei sind wir in vier Hamburger Bezirken aktiv, die statistisch eine hohe Konzentration von psychosozialen Belastungsfaktoren aufweisen. Wir arbeiten mit vier Trägern aus dem Bereich Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe aus den Bezirken Wandsbek, Mitte, Altona und Harburg zusammen. Darüber hinaus bilden wir ein Netzwerk mit Einrichtungen der Frühen Hilfen, Kinderschutz, KipeE-spezialisierten Akteuren, der Suchthilfe, der ambulanten Sozialpsychiatrie und Kliniken mit Eltern-Kind-Stationen. Wir sind in engem Austausch mit den bezirklichen Jugendämtern in den Projektbezirken.
Was sind die Hauptanliegen Ihrer Tätigkeit bezogen auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen in belasteten Familien?
Unsere Vision ist es, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern gesehen und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. Sie sollen individuelle Hilfen erhalten - und zwar nicht zufällig, sondern weil systematisch nach ihnen gefragt wird.
Dafür ist unsere wichtigste Aufgabe, Fachkräfte zu befähigen, die Kinder zu sehen und erkennen zu können. Dabei müssen sie die gestellten Anforderungen der Kinder annehmen und die Tragweite der Herausforderungen abschätzen. Gleichzeitig erfordert diese Sensibilität eine Kompetenz der Konfliktfähigkeit, da die unterschiedlichsten Systeme auch Widersprüche im Familienalltag und in der eigenen Profession erzeugen. Wir ermutigen die Fachkräfte in einem Netzwerk zu arbeiten, welches die Kompetenzen des anderen nutzt und offen und zugewandt agieren kann. Interdisziplinarität ist ein wichtiges Kriterium.
Es gilt also nicht nur die Kinder aus dem Schatten zu holen, sondern ebenso die Fachkräfte. Das alles bedarf intensiver Hintergrundarbeit sowie einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind froh, dass es so viele Leute mit guten Ideen gibt, die unsere Mission unterstützen und die Netzwerke aktiv mitgestalten.
Welche Herausforderungen erleben Sie in Ihrem Arbeitsalltag in der Arbeit mit psychisch und/ oder suchtbelasteten Familien bezogen auf Hamburg?
Viele Hilfen, die es gibt, sind für psychisch belastete Familien häufig nicht verständlich und schwer zu erschließen. Es fehlt eine einfach zugängliche Übersicht, denn häufig sind vor allem gute spezialisierte Angebote nicht erkennbar. Eine große Bedeutung hat vor allem die emotionale Situation der Eltern, die beschämt darüber sind, dass sie glauben mit einer Erkrankung als Eltern nicht zu genügen. Hinzu kommt die immer noch verfestigte Angst vor dem Jugendamt. Das Narrativ einer ungünstig verlaufenen Inobhutnahme kann man auch mit vielen gelungenen Hilfeverläufen nicht ausgleichen. Fachkräfte und gestärkte Familien erzählen viel zu wenig diese gelungenen Geschichten und dass es sich lohnt, Unterstützung einzufordern. Antistigmaarbeit ist hier ganz wichtig.
Eine weitere Herausforderung bleibt weiterhin in Hamburg, dass die Angebote für psychisch belastete Familien wie ein Flickenteppich über die Stadt verteilt sind, was unter anderem sehr lange Wege bedeutet. Außerdem fehlen präventive Maßnahmen, „Brücken-Angebote“ zwischen den verschiedenen Institutionen und Leistungen. Das Hilfssystem ist sehr versäult und die Familienperspektive noch nicht genug etabliert. Dadurch gehen Familien verloren oder Hilfeprozesse verlaufen unabgestimmt.
Gibt es aus Ihrer Sicht gelungene Praxiserfahrungen bzw. geeignete Orte aus Ihrem Arbeitsumfeld für eine verbesserte Vernetzung der Fachkräfte aus den verschiedenen Sektoren?
Da gibt es vor allem den ganz persönlichen Gewinn der Menschen in ihrer Rolle als Fachkraft. Wenn ich erkenne, was ich auf meiner Ebene tun kann - wie z. B. die Kinderärztin mit einem Hinweis auf ein Beratungsangebot und die Erzieherin in der Kita mit einem kleinen individuellen Angebot für das Kind - und die Sichtweise des anderen zulassen kann, dann sind wir schon ein großes Stück weiter. Die wichtigste Erkenntnis ist dabei: Ich kann etwas tun. Das ist eine Entscheidung und damit Selbstermächtigung jeder einzelnen Fachkraft. Dazu gehört innere Freiheit, Neugierde, Mut oder Zeit für das Kennenlernen des anderen nehmen. Psychosozial, pädagogisch und gesundheitsbezogen Handelnde müssen die Gelegenheiten bekommen, beruflich, institutionelle Beziehungen zu gestalten – dann ist das Gelingen schon sehr nahe. Kooperation entsteht nicht aus dem Nichts, wenn der Fall da und Druck im System ist. Die Zeit, die wir für Klientenbeziehungen oder für gute Elternarbeit brauchen benötigen auch die Fachkräfte - mit Orten der Begegnung, wie z. B. die Zusammenarbeit im Sozialraum oder mehr Kontakte außerhalb der Arbeitsorte – gemeinsame Supervision, Fortbildung, gegenseitige Hospitationen, Sozialraumpartys und Zeit für Persönliches. Wir müssen bewusst Orte des Zusammenkommens gestalten - sowohl online als auch in echt, denn das Thema bleibt sonst in den einzelnen Bereichen isoliert hängen. Das tut A: aufklaren z. B. mit unseren Fortbildungen, Supervisionsgruppen, Walks & Talks und Arbeitskreisen. Kooperation ist kein Hobby, sondern ein Qualitätsstandard.
Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen aus psychisch und oder suchtbelasteten Familien in Ihrer Region Hamburg?
Ich wünsche mir eine gemeinsame Verantwortung aller Akteure des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und der Prävention in Hamburg, von Leistungserbringern, Kostenträgern, Planern und Budgetverantwortlichen. Ein gemeinsamer fachpolitischer Wille systematisch das Hilfssystem für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil auszubauen und zu vernetzen - wie es die Empfehlung Nr. 18 zur „Erstellung Kommunaler Rahmenkonzepte“ der gemeinsamen Bundesarbeitsgruppe vorsieht. Es braucht eine gemeinsame Zielstellung, in die alle einzahlen. Dadurch entstünden Rahmenbedingungen, in denen sich Engagement und Kompetenzen, Innovation und Weiterentwicklung entfalten könnten.
Doch so weit ist es noch nicht, deshalb antworte ich mit einem zweitbesten Wunsch. Da ist die Regelfinanzierung, damit alle, die etwas anbieten wollen, es auch tun können, damit sich gute Praxis entwickeln kann. Ich möchte dazu einladen, dass jeder seine Möglichkeiten prüft, selbst wenn eine Umsetzung nicht gleich geht. Ich sehe heute mehr für das KipeE-Thema engagierte Leute und somit auch mehr Gestaltungsspielräume für unser Anliegen, als es noch vor drei Jahren der Fall war.
Zum Gestalten gehört auch, dass die Nutzer*innen mehr gefragt werden, denn häufig hören wir: „Wem soll ich das jetzt alles schon wieder erzählen?“. Partizipation ist die große Herausforderung. Das Konzept der Genesungsbegleiter finde ich hier sehr vielversprechend.
Schließlich geht es darum, dass jeder seine Handlungsspielräume erkennt und erweitert. Wenn jeder schaut, was er tun kann, die Kinder nicht alleine zu lassen und Eltern zu begleiten – kommen wir große Schritte voran. Letztlich gilt es auch die Chance der gemeinsamen erlebten Pandemieerfahrung zu nutzen und das Augenmerk auf die psychische Gesundheit von Helfer*innen zu lenken.
17.03.2022 Franziska Berthold: Herzlichen Dank, liebe Juliane Tausch, dass sie sich für unser Interview die Zeit genommen haben!“